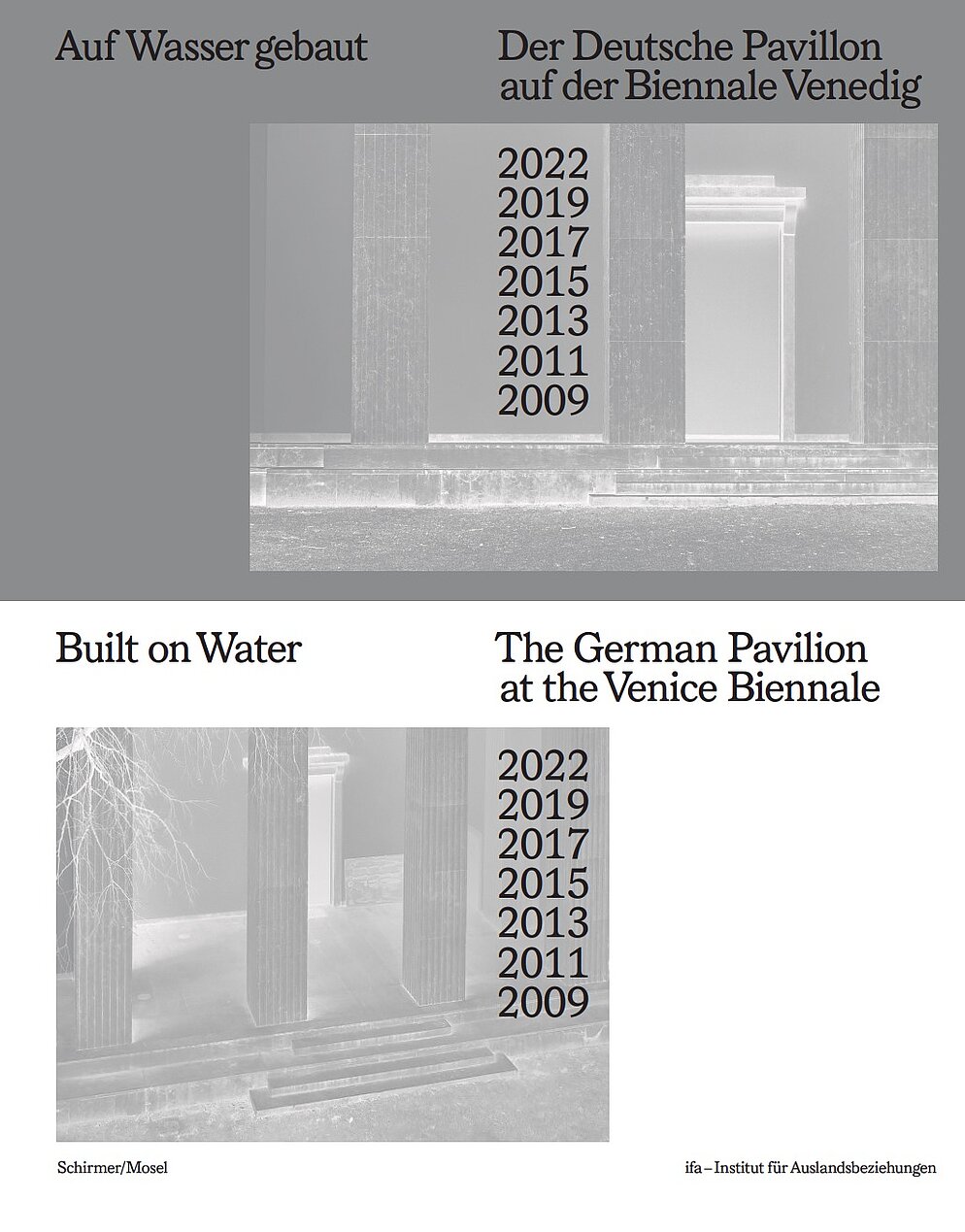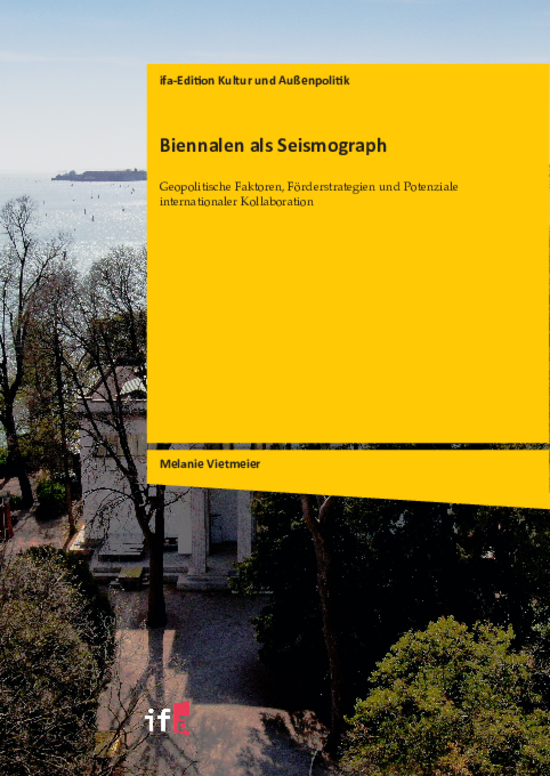2022: Maria Eichhorn – "Relocating a Structure" kuratiert von Yilmaz Dziewior
Text zur Ausstellung
In ihrem künstlerischen Projekt "Relocating a Structure. Deutscher Pavillon 2022, 59. Internationale Kunstausstellung - La Biennale di Venezia" setzt sich Maria Eichhorn mit der wechselvollen Geschichte des Deutschen Pavillons seit den Anfängen der Biennale sowie mit der widerständigen Rolle der Kunst bei der Situierung gesellschaftlicher Verhältnisse auseinander. Zu Beginn des Projekts entwickelte die Künstlerin die Idee, den Deutschen Pavillon für die Laufzeit der Biennale zu translozieren und originalgetreu an gleicher Stelle wieder aufzustellen. Davon ausgehend, ließ Maria Eichhorn im Inneren des Pavillons – der im Grunde aus zwei Gebäuden besteht, dem 1909 errichteten Bayerischen Pavillon und dem Nazi-Erweiterungsbau von 1938 –, durch das Ausgraben von Fundamenten und das Abtragen von Putzschichten die Nahtstellen zwischen den Gebäudeteilen freilegen. Das verborgene ursprüngliche Gebäude konnte so sichtbar gemacht werden. Wandbeschriftungen in englischer, deutscher und italienischer Sprache – mit weißer Farbe mittels Pinsel direkt auf die Wand gemalt – ergänzen die freigelegten Stellen.
Weitere Bestandteile des künstlerischen Beitrags für den Deutschen Pavillon sind eine umfangreiche Publikation sowie Stadtführungen zu Orten des Widerstands und der Erinnerung in Venedig. Die Publikation versammelt Essays und Studien zur Geschichte der Biennale und des Deutschen Pavillons sowie zu weiterführenden kunsthistorischen, philosophischen, stadtsoziologischen und politischen Fragestellungen. Als Sonderdruck erscheint eine Broschüre anlässlich der Führungen zu Orten, die an den antifaschistischen Widerstand sowie an die Deportation und Ermordung de (jüdischen Bevölkerung unter deutscher Besatzung von 1943 bis 1945 erinnern. Die Künstlerin kooperierte dabei mit dem Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser).
Der Titel des künstlerischen Projekts von Maria Eichhorn "Relocating a Structure", kann im übertragenen Sinn gedeutet werden. Denn das "Verrücken von Strukturen" in neue Zusammenhänge stellt nicht nur einen Bezug zur Architektur und zur Geschichte des Pavillons her, sondern verweist auch auf grundlegende Fragen menschlicher Existenz und ethischer Verantwortung.
2019: Natascha Süder Happelmann – "Ankersentrum (Surviving in the Ruinous Ruin)" kuratiert von Franciska Zólyom
Text zur Ausstellung
Wie lässt sich Gemeinschaft jenseits von totalitärer Einheit und Gleichförmigkeit denken? Kuratorin Franciska Zólyom setzt zur Reflexion solcher Fragen auf eine Position, die ästhetische Forschung in konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen aktiviert, aber auch soziale, ökologische oder politische Zustände nicht nur analysiert oder kommentiert, sondern diese auch zu gestalten sucht. Sie hat die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian ausgewählt, die mit Identitäten spielt, sie in Frage stellt und sich für den deutschen Beitrag Natascha Süder Happelmann nennt. Natascha Süder Happelmann bringt das poetische, imaginäre und kritische Potenzial von Kunst zur Entfaltung und begegnet zu schnellen Deutungsversuchen mit freundlicher Vielförmigkeit. Ihre Arbeit artikuliert sich in Text, Bild, Raum und Sound. Ihre Stimme ist voller Fürsprache, wenn sie Widerspruch einlegt. In ihrer Kunst erzeugt sie eine starke Präsenz, um im Handeln und Sprechen mit anderen als Verstärker in den Hintergrund zu treten. Dabei arbeitet die Künstlerin vornehmlich installativ und performativ. Über kollektive Prozesse thematisiert sie den kollektiven und transdisziplinären Aspekt künstlerischer Arbeit. So haben sechs Musiker und Komponistinnen unterschiedlicher musikalischer Traditionen und Stilrichtungen eigens für die Klanginstallation "tribute to whistle" Beiträge für die Trillerpfeife geschaffen. Die Rhythmen und Sounds sind in sich ständig verschiebenden, immer anders überlagernden Konstellationen zu hören. Drei Videos Natascha Süder Happelmanns markieren die Etappen auf dem Weg zum "Ankersentrum". Sie bezeugen und verknüpfen Orte wie die Ankerzentren in Bayern mit Tomatenplantagen in Apulien und dem Rettungsschiff Iuventa, das im Zollhafen von Trapani festgesetzt ist. Website 2019
2017: Anne Imhof – "FAUST" kuratiert von Susanne Pfeffer
Text zur Ausstellung
Blicke treffen sich, aber keine Kommunikation entsteht. Sie nehmen einen wahr, aber erkennen einen nicht an. Nach Gender, individuell und eigen, zugleich aber stereotyp erscheinen die Menschen in Anne Imhofs Malereien und Szenarien. Geräusche, Klang und Kompositionen rhythmisieren wie synchronisieren Raum und Körper in einer gedehnten Zeit, welche sich lose durch Narrationen gliedert. Die von Körpern wie vom Klang beschriebenen Räume und der architektonischer Raum überlagern sich, schieben sich bis zum kurzen Moment ihrer Kongruenz ineinander, um im nächsten Augenblick wieder auseinanderzubrechen. Das Geschehen ist kontingent, alles kann in jedem Moment auch anders sein. Inhalt und Form der Bewegungen sind oft divergent, wodurch ihre Einübung überhaupt erst sichtbar wird. Sie changieren zwischen zäher Alltäglichkeit und rätselhaften Ritualen, zwischen fremdbestimmten wie schematisierten Abläufen oder individuellen Fehlfunktionen, Uniformität und Punk. In der Gruppe formiert, bleibt die ziellose Individualität bestehen. Auch wenn sie gemeinsam singen, singen sie vom Ich. Die Körper in Anne Imhofs Stück sind Subjekte, die sich im permanenten Kampf gegen ihre Objektwerdung befinden – kapitalisierte Körper wider eine stetige Optimierung. Zum Bersten gespannt oder erschlafft, erscheinen die dressierten und fragilen Körper wie von unsichtbaren Machtstrukturen durchzogenes Material. Zugleich ist den Bio-Techno-Körpern ihre mediale Vermittlung bereits inhärent. Sie scheinen sich permanent in konsumierbare Bilder zu verwandeln; sie wollen zum Bild werden, zur digitalen Ware. Anne Imhof begegnet der Brutalität unserer Zeit mit einem harten Realismus. In ihren Szenarien vergegenwärtigt sie, wie der Körper in materiellen und diskursiven, in technologischen, sozio-ökonomischen und pharmazeutischen Grenzziehungen konstituiert wird. Anne Imhof macht so den Raum zwischen Körper und Realität sichtbar, in dem unsere Persönlichkeit überhaupt erst entsteht. Website 2017
2015: Olaf Nicolai, Hito Steyerl, Tobias Zielony und das Künstlerpaar Jasmina Metwaly & Philip Rizk – "Fabrik" kuratiert von Florian Ebner
Text zur Ausstellung
Die künstlerischen Arbeiten von Olaf Nicolai, Hito Steyerl, Tobias Zielony und des Künstlerpaars Jasmina Metwaly & Philip Rizk verwandelten den Deutschen Pavillon 2015 in eine Fabrik der reproduzierenden Bilder, welche Wirklichkeit nicht mehr nur repräsentieren, sondern verändern will. Der Begriff der Fabrik verbindet die vier künstlerischen Positionen, die jeweils auf ihre Weise die Begriffe von Ökonomie und Arbeit reflektieren. Sie machen die Verwerfungen unserer vernetzten und globalisierten Welt sichtbar und widmen sich auf unterschiedlichste Weise dem Zirkulieren von Bildern, Waren und Menschen. Dabei halten alle am "Medium Mensch" fest, als realem Akteur und Protagonisten der Veränderung.
Die Fabrik verfügte über verschiedene Produktionsstätten: Workshop – Olaf Nicolais Installation und Performance "GIRO", Print Unit – Tobias Zielonys Arbeit "The Citizen", Motion Capture Studio – Hito Steyerls Videoinstallation "The Factory of the Sun" und Rooftop 1&2 – Jasmina Metwaly und Philip Rizk mit der skulpturalen Intervention "Draw It Like This" und die Film- und Soundinstallation "Out on the Street – Variationen". Website 2015
2013: Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu Mofokeng & Dayanita Singh kuratiert von Susanne Gaensheimer
Text zur Ausstellung
Kuratorin Susanne Gaensheimer präsentierte in kritischer Auseinandersetzung mit der traditionellen Form nationaler Repräsentation in den Länderpavillons auf der Biennale in Venedig das Format des Länderpavillons als ein offenes Konzept und Deutschland nicht als hermetische nationale Einheit, sondern als aktiven Teil eines komplexen, weltweiten Netzwerkes. Mit Romuald Karmakar, Santu Mofokeng, Dayanita Singh und Ai Weiwei lud sie vier internationale Künstler:innen aus unterschiedlichen Ländern ein, die in unterschiedlicher Form und mit individuellem Fokus – die vermeintliche Eindeutigkeit biografischer, nationaler und kultureller Identität hinterfragten und die Auflösung bestimmter Identitätsvorstellungen im Zuge der Modernisierung und Globalisierung ihrer jeweiligen Lebensrealitäten thematisieren.
Romuald Karmakar beschäftigt sich seit fast drei Jahrzehnten mit deutscher Geschichte, deutschen Themen, deutscher Identität und zeigt in seinen Filmen, dass politische Ideologisierung nicht mehr innerhalb nationaler Grenzen stattfindet. Dayanita Singhs Bildwelt ist von einer Lebensform geprägt, in der klassische indische Gesellschafts- und Familientraditionen mit dem modernen Dasein aufeinanderstoßen. Das permanente Reisen als Fotografin in allen Teilen der Welt ist die Daseinsform, die ihr Leben und Arbeiten mehr bestimmt als die Verwurzelung mit ihrer Heimatstadt Delhi. In Santu Mofokengs photographischen Serien prallen transnationale Entwicklungen, kulturelle Traditionen und persönliche Schicksale aufeinander. Seine Bilder zeigen, wie sich die restriktive Lebensrealität der Apartheid auch auf die spirituelle Identität der schwarzen Südafrikaner niedergeschlagen hat und sich Trauma und Erinnerung in die Landschaft eingeschrieben haben. Der Verlust der kulturellen Identität durch die Kulturrevolution und die Veränderung der chinesischen Gesellschaft im Zuge der Modernisierung des Landes sind zentrale Themen im Werk von Ai Weiwei.
Auf Initiative der Auswärtigen Ämter Frankreichs und Deutschlands fand der deutsche Beitrag zum 50-jährigen Jubiläum des Elysée-Vertrags im Französischen Pavillon statt, und umgekehrt. Website 2013
2011: Christoph Schlingensief kuratiert von Susanne Gaensheimer
Text zur Ausstellung
"Eine Form von Schizophrenie war für meine Arbeit und mein Leben schon immer typisch. Wenn ich nur bei einer Sache wäre, würde ich mich langweilen, käme mein Kopf nicht in Fahrt. Ich muss zwischen der Musik und dem Bild, den Menschen und der Sprache, dem Gesunden und Kranken, dem Lustigen und Traurigen immer die Chance haben, auch das Gegenteil zu behaupten. An die Eindeutigkeit der Welt glaube ich nicht." (Christoph Schlingensief, Mai 2011) Nach dem Tod von Christoph Schlingensief im August 2010 entschieden Kuratorin Susanne Gaensheimer und Aino Laberenz, Ehefrau und langjährige engste Mitarbeiterin Schlingensiefs, das von ihm skizzenhaft angedachte Projekt für den Pavillon nicht zu realisieren, sondern bereits existierende Werke zu zeigen.
Die ausgewählten Werke gaben einen repräsentativen Einblick in sein vielschichtiges Oeuvre. Im mittleren Hauptraum des Deutschen Pavillons wurde die Bühne des Fluxus-Oratoriums Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir installiert, das Schlingensief für die Ruhrtriennale im Jahr 2008 geschrieben hat. In Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir setzt sich Schlingensief mit dem universellen Thema des "Leben wollen, aber Sterben müssen" auseinander. Die Bühne hatte hier mit ihren reichlichen Film- und Videoprojektionen und ihrer Vielzahl von räumlichen und bildhaften Elementen den Charakter einer allumfassenden Rauminstallation. Im rechten Seitenflügel war ein Kino eingerichtet, in dem ein Programm von sechs ausgewählten Filmen aus verschiedenen Schaffensperioden ablief: Menu Total von 1985/86, Egomania von 1986, die Deutschlandtrilogie mit 100 Jahre Adolf Hitler von 1988/89, Das deutsche Kettensägenmassaker von 1990 und Terror 2000 von 1991/92 und United Trash von 1995/96. Der linke Seitenflügel des Pavillons war dem von Schlingensief in Afrika gegründeten Operndorf gewidmet. Neben den Bild- und Dokumentationsmaterialien, die in Afrika bereits entstanden sind, und einem Zusammenschnitt von Via Intolleranza II, Christoph Schlingensiefs letztem Stück, für das er mit Akteuren aus Burkina Faso zusammen gearbeitet hat, enthielt dieser Bereich des Pavillons auch die Projektion von Panoramaaufnahmen der Umgebung der Baustelle. Website 2011
2009: Liam Gillick – "Wie würden Sie sich verhalten? Ein Küchenkatze spricht." kuratiert von Nicolaus Schafhausen
Text zur Ausstellung
Ein Coup! Der Deutsche Pavillon auf der 53. Biennale di Venezia wird von einem einzigen nichtdeutschen und nicht in Deutschland arbeitenden Künstler bespielt. Der Kurator Nicolaus Schafhausen befreit im Jahr 2009 die Biennale von der strikten Einteilung nach Nationen. Sein Argument: "Ich finde es allerdings an der Zeit, auch einmal das Nachdenken über deutsche Themen aus nichtdeutscher Sicht zuzulassen." Dabei ist die spezifische Architektur und die Geschichte des nationalen Pavillons zweifellos eine besondere Herausforderung, gerade in Zeiten des globalisierten Kunstbetriebs. Liam Gillicks Werk verlässt den neutralen Raum und setzt sich der Kluft zwischen Moderne und modernistischem Selbstbewusstsein aus. Der Künstler schafft hypothetische Gesellschaftmodelle, ja soziale Utopien. "Sein Handeln als Kunstproduzent […] erlaubt es ihm Fragen zu stellen, ohne zu einer endgültigen Lösung gezwungen zu sein." (Schafhausen)
"Hat niemand je darüber nachgedacht, ob das Haus entfernt und ein neues gebaut werden soll?" (Gillick)
In der Ausstellung wird die Architektur vollständig von innen und außen gezeigt, die Wände sind weiß, kein Gebäudeteil ist abgesperrt. Ein Modell des von Arnold Bode 1957 geplanten Umbaus in Bauhaus-Manier wird in einem Teil des leeren Raumes gezeigt. "Das Haus ist ein Ort der Erinnerung, es zeigt seine Geschichte." Gillick bricht die Monumentalität der Ausstellungshalle mit den funktionalen und normierten Einbauten einer modernistischen Küche à la Frankfurt. Die Küche steht in Spannung zur Logik des Gebäudes, sie verstellt in ihrer Funktionalität die Ideologie des Pavillons. Doch sie ist auch ein intimer Ort. Gillick selbst arbeitete monatelang in einer Küche am Konzept der Ausstellung, nur gestört durch seine Katze. Und auch in Venedig wird die Küche bewohnt von einer elektronisch gesteuerten Katzenfigur, die Fehldarstellungen, Missverständnisse und Wünsche rund um Gillicks eigene Fragen "Wer spricht? Mit wem? Mit welcher Berechtigung?" äußert. Auch sie stellt Fragen, die nicht zwingend eine endgültige Lösung haben. Website 2009
2007: Isa Genzken – "Oil" kuratiert von Nicolaus Schafhausen
Text zur Ausstellung
"Den Titel finde ich gut, denn das ist es, worum es auf der ganzen Welt geht. Ob Krieg, ob nicht, darum gehts. Um Energie und um Öl." (Isa Genzken)
Ausgehend von dem geschichtsträchtigen Gebäude des Deutschen Pavillons, stellt der Kurator Nicolaus Schafhausen grundlegende Fragen zum Verhältnis von Raum, Standort und Betrachtung, Einsicht und Ansicht. Er wählte eine künstlerische Position, die sich vom strategischen Denken befreit hat und in ihrer Kunst den Realitätsbezug der Betrachter:innen mit aufnimmt. Isa Genzken "gehört zu den unangepassten Künstlern der Gegenwart und trifft die Zeit wie kaum ein anderer zeitgenössischer Künstler." (Schafhausen) Die Multigenre-Künstlerin unterzieht die Ideale des Modernismus und ihre popkulturelle Umcodierung einer Metamorphose, in der Glanz und Elend, Euphorie und Desillusionierung eng beieinander liegen. Genzkens Werke spiegeln unangenehme Widersprüche und Gegensätze stets in Verbindung zu sozialen, ökonomischen, politischen und aktuellen Situationen um Klarheit zu schaffen.
"Kunst und Architektur sollten faschistoide Tendenzen vermeiden. Sie sollten ausgelassen und freundlich, unbeschwert und intelligent sich begegnen und zusammen gehen." (Genzken)
Während der Ausstellung war das Pavillongebäude vollständig eingerüstet und mit einem orangenen Baunetz umspannt. Eine fälschliche Ankündigung zum Umbau oder eine Absage an die monumentalen Vorbelastung? Während der Eingang mit einer Vielzahl an Spiegeln die Distanz zum Selbst und zum Anderen multiperspektivisch nah oder fern rückte, war die große Ausstellungshalle mit einer Vielzahl an objets trouvés ausgestattet, die bei einem einzigen Rundgang in ihrer Gänze nicht wahrgenommen werden konnten: Maskeraden, Totenköpfe, Stofftiere, Puppen, Notenständer, Wasserpfeifen, an der Decke baumelnde Astronautenfiguren. Besonders die Reisekoffer offenbarten die Betrachtenden als Teilnehmer:innen dieses touristischen Massenausflugs in die venezianische Kunstwelt.
"Ich bin nicht an Readymades interessiert. Die Bedeutung liegt in der Kombination der Sachen. In einer Zeit wie heute, der Zeit der Verwahrlosung, ist es wichtig, billige Materialien zu benutzen." (Genzken)
Dabei steht der Ausstellungstitel "Oil" programmatisch als Metapher sämtlicher Arbeiten Genzkes in Venedig. Website 2007
2005: Thomas Scheibitz & Tino Sehgal kuratiert von Julian Heynen
Text zur Ausstellung
"Was mich […] so fasziniert, ist ihr Umgang mit Grundfragen der Kunst unter den Bedingungen zeitgenössischer Kultur." Der Kurator Julian Heynen lud für den Deutschen Pavillon auf der 51. Biennale di Venezia zwei junge Künstler ein, die auf eigene und unabhängige Art und Weise die gegenwärtige bildende Kunstproduktion befragten und neue Vorstellungen schafften. Heynen selbst war es daran gelegen, "dieses System aus Ansprüchen und Gepflogenheiten einmal vom Netz zu nehmen" und der deutschen Kunstrepräsentation zu entkommen.
Mit seinen Werken der Bildhauerei und Malerei, zwei Kunstgattungen, die auf der Biennale zunehmend an Präsenz verloren, vertrat Thomas Scheibitz eine formelle Zersetzung der Sinnlichkeit der materiellen Welt als "Fragmente der zeitgenössischen Realität" (Heynen). Tino Sehgal hingegen entzog seiner Kunst das Materielle vollständig und entwarf ein Gegen zur materiellen Ökonomie der Kunstproduktion: "Ich ändere lediglich die Verfasstheit dessen, was da getauscht wird." (Sehgal) Vom Künstler kreierte Handlungsanweisungen wurden hierbei durch sogenannte Interpreten ausgeführt.
Das Pavillongebäude war aufgeteilt zwischen den beiden Künstlern. Jeder bespielte einen Seitenflügel sowie einen Teil der Haupthalle. Thomas Scheibitz monumentale Skulptur aus Holzplatten Der Tisch, der Ozean und das Beispiel (in Anspielung auf ein Werk René Magrittes) füllte die Apsis, Malereien wie Family by the sea und Modell waren im Nebenraum zu betrachten. Sie alle bedienten sich bekannter Chiffren, entzogen sich jedoch durch Abstraktion und Abwandlung zugleich zu klaren Deutungen eben dieser, es entstand eine kühle Nähe. Die Werke waren vermeintlich durch Personal beaufsichtigt. Im Werk von Tino Sehgal This is so contemporary, umtanzten die Wärter:innen jedoch die Besuchenden und klärten sie als menschliches Wandschild über die Werke auf. Im Nebenraum versuchten die Interpreten von Sehgals Werk This is exchange die Besucher:innen in ein Gespräch über Marktwirtschaft zu verwickeln, die sich wiederum in Anschluss anhand eines Passworts an der Eingangskasse der Giardini die Hälfte des Eintritts zurückzahlen lassen konnten.
2003: Candida Höfer & Martin Kippenberger kuratiert von Julian Heynen
Text zur Ausstellung
Ein knapper Zeitraum für die Produktion einer so bedeutenden Ausstellung: Nur ein gutes halbes Jahr hatte der Kurator Julian Heynen vom Zeitpunkt seiner Berufung bis zur Eröffnung der 50. Kunstbiennale in Venedig. Auch seine Auswahl war dahingehend ungewöhnlich, dass er sich für eine teilweise bereits zuvor ausgestellte Werkserie der Fotografin Candida Höfer und ein neues Werk des bereits 1997 verstorbenen Malers und Multi-Genre-Künstlers Martin Kippenberger. Explizit äußerte sich Heynen, er habe "nicht die Künstler, sondern Arbeiten ausgesucht". Für ihn verband die beiden, als Teil der ersten postmodernen Künstlergeneration, und trotz der werkhaften Unterschiedlichkeit, die "Frage nach dem Ort der am Kunstgeschehen beteiligten Elemente". Der viel bearbeitete Pavillon wurde für Heynen zu einer schlichten Ausstellungshalle und die Erfahrung des Ortes in Beziehung zur Vorstellung von sich selbst ins Zentrum gerückt: "wo [ist] denn überhaupt nach einem vollentwickelten Duchampschen System der Ort eines materiell fassbaren Kunstwerks"?
Das von Heynen ausgewählte und von Kippenbergers Hausarchitekten Lukas Baumewerd umgesetzte Werk "Ventilation Shaft" war Teil der Reihe "METRO-Net World Connection". Ein fiktives weltumspannendes Netz aus U-Bahnlinien Bahnhöfen mit Eingängen und Schächten in Leipzig, Kanada und Griechenland, das nun durch einen sieben Meter langen Lüftungsschacht unterhalb der Giardini vermeintlich eben auch in Venedig zu vernehmen war. Eigentlich für Tokio geplant, war "Ventilation Shaft" nun in der Haupthalle des Deutschen Pavillon zu erfahren, die somit ihre monumentale Leere ausstrahlte. In den beiden Seitenflügeln konnten die 28 Arbeiten von Candida Höfer betrachtet werden. Auch hier: scheinbare, aber konzentrierte Leere. Die Raumaufnahmen (halb)öffentlicher doch menschenleerer Orte wie Theater, Bahnhöfe und Restaurants schafften eine eigentümliche Verbindung von Intimität und Distanz, vor allem durchdrangen sie unsere kulturhistorische westliche Weltwahrnehmung.
Beide künstlerischen Positionen bezeugten eindrücklich die grundsätzlichen Verschiebungen im Zusammenhang von Identität und Ort zur Wende vom 20. ins 21. Jahrhundert.
2001: Gregor Schneider – "Totes Haus u r" kuratiert von Udo Kittelmann
Text zur Ausstellung
Flur und Windfang, Schlafzimmer, Küche, Abstellkammer, Klo, das letzte Loch, das kleinste Wichsen, Puff, das große Wichsen, das Ende, Atelier, Kaffeezimmer, im Kern, Liebeslaube. Was klingt wie eine irritierende Aneinanderreihung alltäglicher bis merkwürdig intimer Raumsituationen stellte im Deutschen Pavillon bei der 49. Kunstbiennale in Venedig den künstlerischen Beitrag von Gregor Schneider dar. Der Kurator Udo Kittelmann wählte einen Künstler aus, der "am Bild extremer Lebensräume" arbeitet, "am Widerstreit der ewigen Gegensätze des Seins". Dabei arbeitete der damals 31-jährige Schneider bereits seit über anderthalb Jahrzehnten am "Haus u r", der andauernden Modifikation des elterlichen Wohnhaus am Stadtrand vom rheinländischen Rheydt. In diesem (lebt und) arbeitet der Künstler und produziert die Ausstattung für seine Werke, die auf die fragmentarische bis vollständige Transplantation, Verpflanzung, Doppelung des "Haus u r" ins "Totes Haus u r" an einen anderen Ort warten, das in Schneiders Sinn "abgetötet" ist. Doch es geht keineswegs um das Klonen von Architektur, vielmehr erkundet die Arbeit die Wirkung des Zustands seiner Räume, und setzt somit den Menschen und den Raum in eine nach innen fühlende Beziehung.
In Venedig betrat man das monumentale Gebäude des Pavillons durch eine bieder wirkende Haustür. Nur 15 Personen konnten gleichzeitig das Werk erkunden, demnach bildeten sich davor lange Schlangen. Hinter dem Eingang erwarteten einen nicht die großen Hallen, sondern schmale Gänge, steile Stiegen, verschachtelte Räume, normierte Durchgänge. Die bundesrepublikanische Nachkriegszeit in Reinform. Man konnte das "Haus" verlassen und hatte nichts Außergewöhnliches bemerkt. Und gerade diese gewöhnliche Erfahrung stellte den von Schneider geschaffenen Lebensraum der (Selbst)Reflexion dar, denn jene Raumschichtungen waren "eher emotional als rational" wahrzunehmen, es handelte sich laut Kittelmann um ein "komplexes Raumsystem unterschiedlicher Atmosphären". Schneider selbst sprach von "unsichtbaren energetischen Skulpturen", die wie eine "zweite Haut" wirkten, immer im Wandel, denn der Zustand der Räume wurde fortwährend fortgeschrieben.
Das Haus als gebaute Seele, wie das Werk "Totes Haus u r" häufig gedeutet wurde, kam Schneiders Traum das gesamte "Haus ur" zu transplantieren, sehr nah. Die Arbeit überzeugte auch die Biennale-Jury und gewann den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag.
1999: Rosemarie Trockel kuratiert von Gudrun Inboden
Text zur Ausstellung
Zur 48. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig überließ die Kuratorin Gudrun Inboden die Bespielung des Deutschen Pavillons der vieleiseitig arbeitenden Künstlerin Rosemarie Trockel. Gudrun Inboden begründete ihre Entscheidung für die Wahl einer einzigen künstlerischen Position für alle Pavillonräume damit, dass der Pavillon "nur als Ganzes ausreichen würde, um der Mobilität ihrer Bilder den nötigen Spielraum zu geben." Rosemarie Trockel war die erste weibliche Soloposition im Deutschen Pavillon. Diese Auswahl war kein Zufall, denn Trockels Arbeit beschäftigte sich seit Jahrzehnten mit der Unterwanderung verkrusteter Geschlechterhierarchien, Rollenbildern und des Kunstbetriebs. Trockels feministischer Vorstoß in der Kunst und gleichzeitig ihr Spiel mit Humor und Ironie sowie ihr Sinn für Ästhetik, machen sie nach wie vor zu einer der prägendsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart.
Die Ausstellung bestand aus drei Videoarbeiten, die in jeweils einem Raum gezeigt wurden. Die einstündige Arbeit "Auge" in der mittleren Halle zeigte in sieben aufeinander folgenden Sequenzen jeweils ein linkes Auge, das die Betrachtenden vermeintlich im Blick hatte. Es handelte sich ausschließlich um Augen von Frauen: dem beobachtenden "male gaze" wurde ein weiblicher Blick, ein unausweichlich "anderes Sehen", entgegengesetzt. Diese Art von Prolog sollte in die beiden Seitenräume führen: den Blick in die Vergangenheit gerichtet, im Film "Kinderspielplatz", wurden Erinnerungen an Freiräume, an die Alltäglichkeit der Unruhe wach. Auf der anderen Seite zu sehen war "Sleepingpill", ein utopischer Schlafraum einer nicht definierbaren Zukunft, der mit künstlichen Materialien und Schlafgelegenheiten, sowie mit gelegentlichen Schlummergeräuschen den zur ewigen Ruhe einladenden Kontrast bildete.
Alternierend zwischen kindlicher Vergangenheit und einer (für immer) schlafenden Zukunft störte jedoch das Auge der Gegenwart diese vermeintliche Entwicklungslogik und "blockiert[e] jeden etwa sich abzeichnenden Totalisierungsprozeß" (Inboden).
1997: Katharina Sieverding & Gerhard Merz kuratiert von Gudrun Inboden
Text zur Ausstellung
Die Biennale in Venedig sei "kein Experimentierfeld" soll die Kuratorin des Deutschen Pavillons Gudrun Inboden gesagt haben, sondern eben ein Ort für "reifere Positionen". Sie beschwor in den Beiträgen der von ihr ausgewählten Künstler:innen das Wahrgenommene als einen "Reinzustand", im "staunenden Fragen" des Seins. Die Fotografin Katharina Sieverding und der Maler und Modellbaukünstler Gerhard Merz waren eingeladen, den Raum zu bespielen und schufen Arbeiten, die "zeigen, was sie zeigen - nicht mehr." (Inboden) Sie sollten im wahrsten Sinne den Betrachter:innen enttäuschen, das heißt auf optische Täuschungen verzichten.
Der zentrale Teil des Pavillons zeigte "Venezia" von Gerhard Merz. Es handelte sich um einen Bau im Bau: ein kantiger, überaus weißer Raum mit neun Metern Deckenhöhe war als unabhängiges Gebäude innerhalb der großen Halle des Pavillons errichtet worden. Schmale Durchgänge führten in die Nebenhallen, die strenge Geometrie hob die Abstraktion dieser architektonischen Raumkunst zusätzlich hervor. Der eigentlichen Form der Halle enthoben, versteckte "Venezia" außerdem jedes Außenlicht, 700 Leuchtstoffröhren ließen jedoch eine gleißend kalte Atmosphäre aufkommen, die sie der warmen mediterranen Sonne Venedigs entgegensetzten.
Bei Katharina Sieverding, die in den beiden Seitenflügeln ihre großformatigen Fotoarbeiten ausstellte, standen mit der Werkserie "Steigbilder" foto- und computertechnische Transformationsvorgänge im Mittelpunkt. Steigbilder können in der naturwissenschaftlichen Darstellung Ablagerungen deutlich machen. Sieverding schichtete in ihren drei- bis vierteiligen Arbeiten massenmediale Themen und Anspielungen so weit, bis eine ästhetische und assoziative Wahrheit nur gedeutet werden konnte.
In dieser Hinsicht befragten beide Künstler:innen die Konstruktion von Wirklichkeiten: Form, Schichtung, Ästhetik. Die Deutung ist letztendlich bedeutungslos, solange "die Kunst‚ist" (Inboden).
1995: Katharina Fritsch & Martin Honert & Thomas Ruff kuratiert von Jean-Christoph Ammann
Text zur Ausstellung
Zum 100-jährigen Jubiläum der Biennale di Venezia stellte der Kurator des Deutschen Pavillons Jean-Christoph Ammann drei künstlerische Positionen aus. Für Ammann bestand die "Herausforderung an den Künstler [sic] darin, sich als ein Resonanzkörper zu verstehen", er fasste "Sinn, Zweck und Funktion der Ausstellung" so auf, dass sie "eine mobilisierende Kraft" besitzt. Für Ammann standen Katharina Fritsch, Martin Honert und Thomas Ruff künstlerisch insofern beieinander, dass "ihnen ein konzeptuelles Denken mit emotionalen Inhalten eigen ist", von außen betrachtet wurden sie auch als postmodernes Trio bezeichnet.
Als das zentrale Werk kann wohl "Museum" von Fritsch gelten, die ein Modell eines (alp)traumhaften Idealmuseums im Maßstab 1:10 in die Mittelhalle des Pavillons gebaut hatte. Aufgesockelt auf eine Höhe von 1,60m und umgeben von einem dunklen Kunstbaumwald, war das achteckige Modell jedoch nur vom Galerieumgang aus einsichtig, von dem aus Fritsch selbst jedoch Schwindelgefühle attestierte. Ebenso abgehoben, jedoch nur im Titel "Ein szenisches Modell des 'Fliegenden Klassenzimmers'", war auch Honerts begehbare Installation. In Referenz an das Buch von Erich Kästner bestaunte das Publikum vermeintlich dreidimensionale Fotografien, wobei diese eher real gewordene Kindheitserinnerungen sein mussten. Die aus Polystyrol gegossenen Romanfiguren verloren jedoch ihre vermeintliche Vertrautheit, wenn man einen Perspektivwechsel vornahm und feststellte, dass sie flach waren wie Aufstellpappen. Auch Ruff spielte mit vertrauten Sehgewohnheiten, griff er doch in den Serien "3D" und "andere Porträts" u.a. auf Fotomaterial der 80er-Jahre zurück, um die dargestellten Gesichter miteinander zu überblenden und somit eine zwar transparente jedoch nicht weniger befremdende Wahrnehmung fototechnischer Manipulationsvorgänge offenzulegen.
1993: Hans Haacke & Nam June Paik kuratiert von Klaus Bußmann
Text zur Ausstellung
Die 45. Biennale di Venezia war die erste Ausgabe, die nach dem Fall der Mauer und somit während einer globalpolitischen Wende geplant und entstanden war. Entsprechend waren diese anstehenden Veränderungen großer Bestandteil der kuratorischen und künstlerischen Positionen. Der kuratorische Team des Deutschen Pavillons unter der Leitung von Klaus Bußmann arbeitete mit zwei Künstlern zusammen, die das Prinzip der Nationalpavillons infrage stellten und durch ihr kosmopolitisches Nomadentum symbolhaft das Gesamtkonzept der Biennale vertraten, so die Jury-Begründung zur Verleihung des Goldenen Löwen für den besten nationalen Pavillon an Hans Haacke und Nam June Paik. Die beiden Künstler galten als "Bildzerstörer […] zwei antipodische[r] Energien" (Die ZEIT, 18.6.1993) aus welcher der Pavillon seine Intensität gewann.
Im Beitrag des Konzeptkünstlers Hans Haacke war die Zerstörung nur allzu offensichtlich. Das Werk "Bodenlos" war ein direkter Eingriff in die Pavillonarchitektur: Haacke hatte die Bodenplatten der Haupthalle zerstören lassen, ein wackeliges und tosendes Trümmerfeld gab Sicht auf die Apsis, die an der Wand mit dem Schriftzug GERMANIA versehen war. Eine Anspielung auf den prangenden Schriftzug am Portikus und die später mit einem dezenten "Bundesrepublik Deutschland" ergänzte Beschriftung an den Außenwänden. Den Eingang zur Halle verstellte eine rote Wand mit einer Fotografie Hitlers zum Zeitpunkt seines Besuchs des Deutschen Pavillons 1934. Der Portikus wiederum wurde, statt wie zuvor mit einem Reichsadler, mit einer überdimensionalen 1-DM-Münze geschmückt. Haackes Arbeiten waren im Ganzen eine unverkennbare Demontage einer wiederaufkommenden alten Nationalnarrative zu Beginn der gesamtdeutschen Bundesrepublik.
Videokünstler Nam June Paik wollte mit seinem Feuerwerk an Bewegtbildern, oder auch selbstbezeichnet als "Electronic Superhighway" und "Datenautobahn", die visuellen und medialen Wahrnehmungsgrenzen sprengen. Die Monitorwände und Video-Skulpturen in den beiden Seitenflügeln ließen die Besucher:innen unendlich oft wiederholt hin und her zappen, mit seinen monumentalen Außenraumfiguren wollte Paik mit Kunsttechnologie die Außenwelt erobern: U.a. "Marco Polo", "Katharina die Große" oder auch "Dschingis Khan" waren aus Elektroschrott auferstanden und bildeten die Hardware für eine optische Überreizung, eine mediale Abnutzung.
Haacke und Paik waren mit ihren Beiträgen am Puls der Zeit, in der es um Neuformulierungen von Identitäten und einer Gesellschaft ging, die zunehmend von Informationen und Konsum geprägt wurde.
1990: Bernd & Hilla Becher & Reinhard Mucha kuratiert von Klaus Bußmann
Text zur Ausstellung
Die Frage nach Formsprache und Zweckgebundenheit, gerade im industriellen Zeitalter, stellten sich die Beiträge zum Deutschen Pavillon auf der 44. Biennale in Venedig. Der Kommissar Klaus Bußmann wählte Positionen aus, die in Präzision die "große Tradition der Neuen Sachlichkeit der zwanziger Jahre für unsere Gegenwart fruchtbar" machten, die jedoch ebenso die fast schon ad absurdum geführte Ordnung gerade in jenen Jahren des deutschen Wandels zur Schau stellten. Die Werke des Künstlerpaars Hilla und Bernd Becher sowie des Modellbaukünstlers Reinhard Mucha wurden in den Räumen des nun letztmalig westdeutschen Pavillons der Bundesrepublik gezeigt.
Im "Deutschlandgerät" von Reinhard Mucha wurde ein Raum im Raum gebaut, die Mittelhalle des Pavillons wirkte dadurch verschachtelt und verengt. Die steinernen Bodenplatten setzten sich an den Raumwänden fort, gläserne Schaukästen inszenierten im Inneren Holzbohlen aus Muchas Düsseldorfer Atelier. Die Gesamtheit der Apsiswand war versehen mit 40 eingefassten Holz- und Messinghockern. Der Werktitel, angelehnt an die Fabrik "Deutschland" die zuvor in Muchas Atelierräumen mit großem Erfolg im Kaiserreich einen "druckluft-hydraulischen Aufgleiser" produziert hatte, öffnete jedoch auch ein mehrdeutiges Gedankenspiel. Mit typischer Akribie hatte Mucha ein Netzwerk aus Bezügen und Hinweisen zwischen persönlichen und historischen Motiven geschaffen.
In den 340 ausgestellten Fotografien des Künstlerpaars Becher zeigten sich drei Jahrzehnte ihres Schaffens, das aber durch Bußmann klar als "work in progress" bezeichnet wurde. Zu jenem Zeitpunkt ihrer Karriere sprach man bereits von der "Becher-Schule" und das Künstlerpaar stand wie kaum jemand für die Etablierung der Fotografie als eine Kunstgattung. In ihrer scheinbar moderesistenten Arbeit einer Industriearchäologie zeigten die Bechers auch in Venedig eine neutrale, funktionsgebundene Ästhethik von Industriebauten auf, in diesem Fall "Wassertürme". Bereits 1969 prägten sie mit der formalen Kontinuität in ihrer fotografischen Praxis den Ausdruck der "anonymen Skulptur". Auf der Biennale 1990 erhielten sie den Goldenen Löwen für Skulptur.
1988: Felix Droese kuratiert von Dierk Stemmler
Text zur Ausstellung
Für den deutschen Beitrag zur Kunstbiennale in Venedig im Jahr 1988 hatte der Kommissar Dierk Stemmler den Künstler Felix Droese eingeladen. Für Droese stellte die Ausstellung in Venedig die Möglichkeit dar, seine Arbeit der voran gegangenen Jahre gestalterisch und politisch zu bündeln. Als ehemaliger Schüler von Joseph Beuys war die politische Aktion schon immer Teil der künstlerischen Intervention.
So hatte Droese den Deutschen Pavillon kurzerhand in "Haus der Waffenlosigkeit" umbenannt, welches nun auf einem Eisenschild als Überschrift oberhalb der Beschriftung Bundesrepublik Deutschland an der Außenwand prangte. Sicherlich eine Geste um der nationalhistorischen Vereinnahmung zu entgehen, aber auch um Gegenkräfte zu beschwören: "Kraft habe nicht nur, wer Waffen besitze, sondern auch, wer sich etwas vorstellen könne". Droese nutzte dies um seine monumentalen Scherenschnitte (meist ohne Titel) in einer Art metaphysischem Raum wirken zu lassen. Denn die schattenhaften, märchenanmutenden Schnitte in Ergänzung zur raumgreifenden Skulptur der Baumstammscheiben einer zersägten 200-jährigen Eiche stellten in doppelter Weise die rätselhaften und doch klaren Themen der Ausstellung dar.
Tod und Erlösung, u.a. dargestellt durch Tierskelette und in die Architektur eingefasste Pforten, sollten durch die Kunst Autonomie gegenüber dem historischen Schicksal bringen: "Man kann aus der Geschichte, sobald man geboren ist, nicht mehr aussteigen" so bisher die These. Droese schaffte starke Bezüge zur christlich geprägten Welt und spielte daher mit christlichen Bildern und Vorstellungen. Doch entgegen den Kontroversen um die Religion ("Der Krieg gehört zum christlichen Gedankengut"), sah Droese die Nächstenliebe und das Leid als eine Verantwortung der Kunst, um ganz im Sinne seines Lehrers Beuys und der sozialen Plastik die "große Menschheitsfrage des gemeinschaftlichen Lebens zu lösen".
1986: Sigmar Polke kuratiert von Dierk Stemmler
Text zur Ausstellung
Mit dem deutschen Beitrag zur 42. Kunstbiennale in Venedig konnte der Kurator Dierk Stemmler einen großen Erfolg verzeichnen, denn seine Auswahl des Künstlers Sigmar Polke brachte Letzterem die Auszeichnung des Goldenen Löwen als besten Künstler ein. Stemmler bezeichnete Polke als "Forscher, Erfinder, Entdecker, Verwandter", der nichts übersehe und "durch das ganz Andere zu sich selbst" gehe. Das Thema der Biennale "Kunst und Wissenschaft" wurde im Deutschen Pavillon sehr genau umgesetzt, verwandelte dieser sich doch in die Alchemiewerkstatt "Athanor".
Polke, der bereits ein viel beachteter und umtriebiger Künstler war, nahm sich seiner selbsternannten "Sonderaufgabe" an und stellte drinnen und draußen Grenzzonen infrage. So etwa das Werk "Der Polizist und das Schwein", das bereits im Außenbereich des Pavillons auf realsatirische Weise die Binarität für oder gegen staatliche Autorität ansprach. Im Innenraum des Pavillons wurde die Auflösung noch offensichtlicher: Mensch und Natur, Zufall und Kontrolle, Glaube und Vernunft. Eine Vielzahl an Werken unterschiedlicher Form waren im gesamten Gebäude verteilt, eine ordnende Erklärung konnte und sollte wohl nur schwerlich gefunden werden.
Sowohl metaphorisch, wie etwa mit Materialien wie Quarz (Licht, Geburt), Meteorit (Außerirdisch, Tod) oder Zinnober (Stein der Weisen, Leben), als auch technisch wollte Polke Fantasie anregen. Auf Malereien angebrachte Jodkörner reagierten auf das einfallende Licht, die Hydro-Malereien reagierten auf die bestehende Luftfeuchtigkeit, die Thermo-Bilder veränderten ihre Form durch die Körpertemperatur der anwesenden Besucher:innen. Sigmar Polke entzog den Deutschen Pavillon durch seine vieldeutige und phantasiereiche Kunstsprache einer ideologischen Vereinnahmung und gab eine eindeutige Didaktik zugunsten fantasievoller Vieldeutigkeit und Ironie auf.
1984: Lothar Baumgarten & A.R. Penck kuratiert von Johannes Cladders
Text zur Ausstellung
Als 1982 die DDR zum ersten Mal mit einem eigenen Beitrag auf der Biennale in Venedig ausstellte, folge für die nächste Ausgabe prompt eine Reaktion durch die BRD: Der Deutsche Pavillon wurde mit dem Schriftzug "Bundesrepublik Deutschland" (und dem italienischen Äquivalent) bestückt. Auch die künstlerischen Positionen, die Johannes Cladders mit Lothar Baumgarten und A.R. Penck auswählte, reflektierten das Spiel um lokale Betitelungen, sei es deutsch oder venezianisch.
So fütterte Penck, der selbst erst seit vier Jahren in Westdeutschland lebte, die deutsch-deutsche Kontroverse, indem er Werke ausstellte, die noch zu seinen DDR-Zeiten entstanden waren. Die Malerei-Serien "Mike Hammer" (auch ein früheres Pseudonym Pencks) sowie "Standart" (Kofferwort aus standardisierten Sprach- und Bildzeichen und "Art", englisch für Kunst) sollten dabei die Selbstverständlichkeit westlicher Kunstauffassungen infrage stellen. Seine markenhaften Piktogrammdarstellungen waren neutrale Chiffren, die für Penck einen Spielplatz der Zeichensysteme darstellten: "Das Bild fragt den Betrachter".
Lothar Baumgarten wiederum bespielte den Boden des Pavillons: Im Gebäude waren Intarsien von auf geometrische Formen abstrahierten Tieren eingelassen. In "venezianisch rot" prägten ebenso lateinamerikanische Flussnamen rechtwinkling angeordnet das Bodensytem, nur gebrochen durch den dominierend schwarzen "America"-Schriftzug nahe der Apsis. Der Name des Kontinents stammt schließlich von einem seiner vermeintlichen Entdecker, Amerigo Vespucci, der wiederum einen Ort "Klein-Venedig" nannte, das heutige Venezuela. Baumgarten schaffte hier also eine zweifache Rückspiegelung projizierter Kulturtransfers. Begleitet war der Beitrag Baumgartens, der selbst einige Zeit beim Yanomami-Volk in Venezuela verbracht hatte, durch eine erklärende Publikation, eine doppelt wirksame Festschrift an die Kulturen der oral history.
1982: Hanne Darboven & Gotthard Graubner & Wolfgang Laib kuratiert von Johannes Cladders
Text zur Ausstellung
Unter dem Thema "Kunst als Kunst – Die Beständigkeit des Werkes" der 40. Kunstbiennale in Venedig lud der Kurator Johannes Cladders drei Künstler:innen zur Bespielung in den Deutschen Pavillon ein. Gerade die Frage um die künstlerische Beständigkeit sollte die sehr unterschiedlichen Positionen von Hanne Darboven, Gotthard Graubner und Wolfgang Laib insbesondere verbinden und die Raumarchitektur ihrer historischen Aufladung entladen.
Die Mittelhalle übernahm der Maler Gotthard Graubner, der mit seiner Arbeit "Farbraumkörper" eine 4x4 Meter große Skulpturmalerei in situ geschaffen hatte: einige Zentimeter über dem Boden schwebend war die Leinwandmit Synthetikwatte aufgefüllt und roter Farbe durchtränkt, es entstand der Eindruck eines übergroßen Kissens. So positioniert, dass es mit der Apsis abschloss, wirkte das Werk durch Monumentalität in Dimension und Farbe wie ein Altarbild, eine Offenbarung, eine mystische Botschaft, die auch den Raum herum grundlegend anders wahrnehmen ließ.
Wolfgang Laib befragte im linken Seitenflügel ebenso die Möglichkeiten der Wahrnehmung bzw. Beständigkeit von Raum und Kunst: Ein weißer Marmorblock, an der Oberfläche ausgehöhlt und aufgefüllt mit Milch, am Boden daneben ein Viereck bestehend aus aufgehäuften Löwenzahnblüten. Auf einem Wandregal im Nebenraum fünf Einmachgläser, befüllt ebenso mit einer Auswahl an Blütenstaub. Die Werke "Milchstein" oder "Blütenstaub" rekurrierten dabei nicht nur auf die mythische und symbolische Aufladung durch die Natur, sondern auch auf die innere Raumordnung im Pavillon, die durch Licht- und Schattenverhältnis die geometrische Zerlegung der Komponenten mitbeeinflusste.
Im rechten Seitenflügel schließlich hatte Hanne Darboven die Wände vollumfänglich mit ihrem Werk "Weltansichten 00-99" ausgestattet. Von oben bis unten hingen 1.400 gerahmte Schriftblätter und stellten den kompletten Kalender des 19. Jahrhunderts dar: 100 Jahre à 53 Wochen à 7 Tage à 24 Stunden. Diese Materialisierung einer linearen Zeit zeichnete sich zudem durch die ergänzende Abbildung von 100 Kupferstichen berühmter Sehenswürdigkeiten aus. Die Firma Darboven, Vorfahren der Künstlerin, hatte diese historisch als Werbemittel produziert.
1980: Georg Baselitz & Anselm Kiefer kuratiert von Klaus Gallwitz
Text zur Ausstellung
"Aperto Ottanta" (Offen 80) – so eröffnete die 39. Kunstbiennale die anbrechende Dekade der 1980er-Jahre. Der Kurator Klaus Gallwitz hatte hierfür die Avantgarde-Künstler Anselm Kiefer, Georg Baselitz und Markus Lüpertz eingeladen den deutschen Beitrag beizusteuern. Letzterer sagte ab, die beiden Anderen schafften eine politische Ausstellung, die in ihrer Schlagkraft die Kunstkritik nachhaltig prägte: Handelte es sich um Werke, die sich die faschistische Rhetorik der nationalsozialistischen Vergangenheit aneigneten oder wollten die Werke eben jene in brachialer Weise unvergesslich machen, eine Negation negieren?
Anselm Kiefer präsentierte in den beiden Seitenflügeln monumentale Malereien aus Kohle, Öl und Eisenoxyd auf Rupfen und Raufasertapete. Insbesondere "Deutschlands Geisteshelden" und "Parzival" vermittelten den Eindruck, man könne in die lebensgroßen Bildräume eindringen. Zu sehen waren aus Holzbalken geschaffene Räume zwischen Dachboden und Ruhmeshalle, zwischen Gedenkraum und Rumpelkammer. Joseph Beuys, Robert Musil, Richard Wagner - Heldennamen, die die Wände flankierten und ebenso herumgeisterten in diesem Deutschen Pavillon, einem Gebäude, gebaut im Sinne nationalsozialistischer Architektursprache.
Mit "Modell für eine Skulptur" überraschte der Maler Georg Baselitz nicht nur mit einer medialen Neuheit, sondern erhitzte die Gemüter umso mehr mit der Darstellung: strenge Haltung, Frisur und Oberlippenbart der in Apsis sitzenden Figur deuteten Hitler an, die Geste des ausgestreckten rechten Arms verstärkte diese Lesart. In Schwarz-Rot-Gold bemalt sollte das Werk jedoch ebenso als ein Warnsignal für aufkommende faschistoide Wiedererwachen gelten.
So schreibt der Kunstkritiker Bazon Brock in Anerkennung der Ausstellung: "Die affektive Betroffenheit vor jenen Werken rührt […] daher, daß diese Künstler […] genau die Sachverhalte bewußt oder unbewußt treffen, aus den die Lage der Nation sichtbarer wird als aus den entsprechenden regierungsamtlichen Verlautbarungen."
1978: Dieter Krieg & Ulrick Rückriem kuratiert von Klaus Gallwitz
Text zur Ausstellung
Die damals viel diskutierte Land Art fand in der 38. Kunstbiennale in Venedig ihren Widerhall und so konnte der Titel dieser Ausgabe "Von der Kunst zur Natur, von der Natur zur Kunst" als Reaktion darauf gelesen werden. Auch die Beiträge im Deutschen Pavillon waren in diesem Bezug zu sehen, denn Kurator Klaus Gallwitz hatte zwei Künstler eingeladen, die das Gebäude im übertragenen Sinne mit Felsboden und Wandvegetation versahen. Die konzeptuellen, abstrakten Werke von Maler Dieter Krieg und Bildhauer Ulrich Rückriem verliehen der Ausstellung eine kontemplative Stimmung.
So waren die Arbeiten Dieter Kriegs in den beiden Seitenflügeln zwar großformatig, doch, entgegen seiner üblichen Produktionen, gemalt auf leichten Papierbögen und direkt an der Wand befestigt. In freier Gestik, zwischen Abstraktion und Figuration, wurden Körper deutlich, verwoben mit zersplitterten Baumstämmen und durchaus in quälender Haltung. Kriegs Malereien waren belgeitet durch eine monotone Tonbandlesung, die in schier nicht enden wollender Manier stoisch die Lexikoneinträge von unzähligen Künstler:innen vorlas.
Ulrich Rückriem wiederum hatte vor der Apsis der Haupthalle seine Plastik "Zerteilen – Verteilen" positioniert. Die vier unbearbeiteten Quader aus blauem Dolomitstein waren so angeordnet, dass die Besucher:innen eingeladen waren zwischen ihnen zu laufen sowie von oben auf sie herabzuschauen. "Skulptur – Mensch – und dann geht es ganz steil nach oben." Rückriem beschrieb dies als eine Art Kurve, die das Pathos der architektonischen Höhe unbeachtet ließ und den Raum wieder auf die menschlichen Dimensionen zurückholte. Ebenso betonte der gebrochene Stein in seiner Form die ursprüngliche Beziehung von Mensch und Material.
1976: Joseph Beuys & Jochen Gerz & Reiner Ruthenbeck kuratiert von Klaus Gallwitz
Text zur Ausstellung
Die Biennale erlebte mit der 37. Ausgabe ihre "Wiedergeburt", wie es oft hieß. Mit einer Politisierung im Jahr 1974 wurde in Form eines spartenübergreifenden Festivals versucht mit linkspolitischen Interventionen die reaktionär-elitäre Struktur aufzubrechen, sowie eine klar solidarische Geste an Chile auszusenden, das unter der Pinochet-Diktatur litt. Das Format war so speziell, dass es nicht in die Biennale-Chroniken aufgenommen wurde und 1976 war die Biennale-Leitung zur klassischen Kunstausstellung zurückgekehrt, jedoch mit ein paar Neuerungen: Das Nebeneinander der Nationalpavillons sollte erstmals mit einem vereinenden Thema überdacht werden, auch sollte das künstlerische Programm medial um die Nachbardisziplinen Architektur, Design und Fotografie erweitert werden. "Ambiente e Fisico", Umwelt und Körper, dies wurde auch von den drei Künstlern umgesetzt, die von dem Kurator Klaus Gallwitz in den Deutschen Pavillon eingeladen worden waren: Joseph Beuys, Jochen Gerz und Reiner Ruthenbeck.
Das Werk "Straßenbahnhaltestelle" stellt den Beitrag des schon damals berühmten Künstlers Beuys dar. Platziert in der Mittelhalle bestand es aus einem aufgerichteten Abguss einer Kanone, gekrönt mit einem Kopf, der leidend herausschaute. Dahinter befand sich ein Bohrloch, das bis hinunter zur Lagune reichte, während der Bohrschutt daneben lag und die Geschichte des Untergrunds zutage brachte. Ergänzend waren im Boden Bahngleise aus Beuys' Heimatstadt Kleve eingelassen. Beuys erschuf mit seiner Installation ein sowohl historisch-mythisch wie auch autobiografische Arbeit, die die Verschachtelung verschiedener zeitlicher und geografischer Lebens- und Erlebnisebenen aufweisen wollte.
Auch das Werk "Die Schwierigkeit des Zentauren beim vom Pferde steigen" von Jochen Gerz, das im rechten Seitenflügel zu sehen war, schöpfte aus der Mythologie, spielte jedoch umso mehr mit Ironie und Verwirrung. Eine neun Meter hohe Holzkonstruktion stellte die durch eine Mauer zerteilten Hälften eines Pferdewesens dar. Hohl und innen begehbar konnte es auch als das Biennale-Konzept unterlaufende Trojanische Pferd gelesen werden. Unten wiederum standen Pulte mit Texten, die der Künstler eigenhändig und spiegelverkehrt geschrieben hatte, die Besucher konnten sie nur mit den dort ausgegeben Handspiegeln entziffern.
Das Thema der räumlichen Umgebung fasste die Arbeit "Doorway" von Reiner Ruthenbeck wohl am genauesten auf. Im linken Seitenflügel ließ er schwarze Gummiseile die architektonischen Elemente des Pavillonraums nachziehen und schaffte hiermit eine zuvor unbemerkte Betonung. Durch die Verengung der gespannten Linien in den Türrahmen war eine Art Seh-Trichter geschaffen, der die Sichtweisen dreidimensional nachzeichnete und das Verhältnis von Ausdehnung und Restriktion umdrehte, verdeutlichte.
1972: Gerhard Richter kuratiert von Dieter Honisch
Die Rechte zur Verwendung der Abbildungen wurden von den Eigentümer:innen und Rechteinhaber:innen eingeräumt oder sind Teil unseres eigenen Archivs. Die Ermittlung der Rechte erfolgte nach besten Bemühungen. Konnten die Rechteinhaber:innen nicht korrekt ermittelt werden, bitten wir um Nachricht und werden berechtigte Ansprüche im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgelten.